Daten und deren Nutzbarmachung für eine funktionale, effiziente und nachhaltige Stadt sind seit jeher Schlüsselanliegen der Smart City Community. Jenseits von Absichtserklärungen gab es auf der Umsetzungsebene jedoch über viele Jahre kaum Fortschritte beim Aufbau übergreifender Dateninfrastrukturen in der Verwaltung. Das ändert sich gerade: Unter anderem unterstützt durch das Smart City-Förderprogramm des Bundes machen sich immer mehr Kommunen auf den Weg, professionelle Datenmanagementsysteme aufzubauen. Grund genug, dass auch wir uns mal wieder etwas eingehender mit der Frage beschäftigt haben, wie ein übergreifendes Datenmanagement für die öffentliche Verwaltung aussehen kann.
Dateninfrastruktur – Fundament einer smarten Stadt
Zuallererst: Was ist mit Datenmanagement eigentlich gemeint und was ist daran so schwierig? Städte und Kommunen häufen, teils als Beiwerk, teils durch gezielte Erhebungen, große Mengen an Daten an. Darunter fallen zum Beispiel geographische Informationen unterschiedlicher Art, Verkehrs- und Mobilitätsdaten, Daten zur Energie- und Wasserversorgung, Wetter- und Umweltdaten, Daten aus dezentralen Sensornetzwerken (z.B. zu Luft- und Wasserqualität), Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftsstatistiken und nicht zuletzt Daten, die beim Verwaltungshandeln (also bei Antrags- oder Fachverfahren) selbst entstehen. Diese Datensätze werden in aller Regel nicht zentral erfasst, sondern liegen je nach Zuständigkeit in verschiedenen Ressorts, aber auch in unterschiedlichsten Formaten und Strukturen vor. Sie so aufzubereiten, dass sie übergreifend auffindbar und nutzbar sind, dass Redundanzen vermieden werden und gleichzeitig sensible Daten vor unerlaubtem Zugriff geschützt sind – all das fällt unter den Oberbegriff des städtischen Datenmanagements.
Grundlage für Open Data und effiziente Verwaltungsarbeit
Im CityLAB und bei der Open Data Informationsstelle (ODIS) beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit der Aufbereitung und Verwertung von Verwaltungsdaten als Open Data. Mit einem breiten Angebot an unterschiedlichen Formaten und Ressourcen unterstützen wir die Berliner Verwaltung zum Beispiel bei der Umsetzung der Open Data-Rechtsverordnung und der 2023 veröffentlichten Open Data-Strategie. Diese Strategie legt über die Notwendigkeit der Bereitstellung offener Daten für Dritte erstmals auch einen Fokus auf die Verbesserung des verwaltungsinternen Datenmanagements. Dieses ist schließlich die Grundlage dafür, dass Verwaltungen in die Lage versetzt werden, qualitativ hochwertige und aktuelle Daten mit der Öffentlichkeit zu teilen und darüber hinaus die Verwaltungsarbeit effizienter zu gestalten.
Städtische Datenplattformen – eine für alle?
Die auf den ersten Blick naheliegende Idee, einfach alle Verwaltungsdaten an einem zentralen Ort vorzuhalten, erweist sich bei näherer Betrachtung schnell als realitätsfern. Zur nach wie vor äußert heterogenen IT-Landschaft der öffentlichen Verwaltung kommen ebenso unterschiedliche Prozesse, Anforderungen, Zuständigkeiten und Abhängigkeiten. Während einige Verwaltungen längst eigene Datenplattformen betreiben, die speziell auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind (Vorreiter sind hier oft Ressorts wie Umwelt, Verkehr oder Stadtentwicklung, aber auch Statistikämter[1]), werden andernorts noch Excel-Dateien oder PDFs per Mail hin- und hergeschickt.
Plausibler und in vielen Städten bereits im Aufbau: Zentrale Plattform-Systeme, die bestehende dezentrale Infrastrukturen über offene Schnittstellen miteinander verbinden, durchsuchbar machen und um zusätzliche Visualisierungs- und Analysewerkzeuge erweitern. Hier ist nicht nur ein reger GovTech-Markt entstanden, sondern Entwicklungsgemeinschaften, in der zahlreiche Kommunen ihre Ressourcen bündeln und den Aufbau modularer Open Source-Suiten zum Datenmanagement vorantreiben, wie beispielsweise die Entwicklungsgemeinschaft des Vereins Civitas Connect e.V. oder die Entwicklungsgemeinschaft um die Urban Data Space Plattform, die gemeinsam mit dem FUTR Hub der Tegel Projekt GmbH entwickelt wurde. Die Idee: Bestehende Plattformen und Verfahren lassen sich an das offene System anbinden, mit Metadaten versehen und zur weiteren Nutzung aufbereiten. Neben Systemen zum API- und Rechtemanagement setzt die Core-Plattform von Civitas auf bewährte Tools wie Grafana oder Superset, um Daten für Entscheidungsträger:innen oder die Öffentlichkeit verständlich aufzubereiten.
ETL-Prozesse und Datenpipelines
Wenn Daten aus mehreren Quellsystemen in ein Zielsystem übertragen werden, ist es oft sinnvoll, sie unterwegs zu transformieren, etwa um die Datenqualität zu verbessern, Daten zu vereinheitlichen, oder anderweitig anzureichern. Zur Durchführung dieser sogenannten ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load) existieren nützliche Open Source-Werkzeuge wie Node-RED, die durch eine grafische Benutzeroberfläche die Verknüpfung von Systemen und das Erstellen von Datenpipelines erleichtern. Gleichwohl sind zur effektiven Nutzung dieser Tools zumindest rudimentäre Programmier- bzw. Skripting-Kenntnisse, sowie ein solides technisches Verständnis von Datenbanken und -formaten erforderlich.
Kartenanwendungen – zeigen, wo es langgeht!
Georeferenzierte Daten bieten noch weitere Visualisierungsmöglichkeiten, etwa in interaktiven Karten, die bei Beteiligungsprozessen in der Stadtentwicklung oder zur Erstellung übersichtlicher Informationsangebote genutzt werden können. Hier entwickelt sich das in Hamburg unter Open Source-Lizenz entstandene Masterportal immer mehr zum Verwaltungs-Standard, zumal die Software kontinuierlich erweitert wird und vergleichsweise gut mit anderen Open Source-Komponenten harmoniert.
Wie vielseitig Geodaten bei der Entwicklung digitaler Angebote genutzt werden können, lässt sich in zahlreichen CityLAB- und ODIS-Projekten nachvollziehen: Projekte wie Gieß den Kiez, der Weihnachtmarkt-Finder, der Branchenpuls und viele mehr wären ohne offene Geodaten nicht möglich.
Metadatenkataloge – Ordnung in das Chaos bringen
Um Datenbestände auffindbar und nachnutzbar zu machen, braucht es in den meisten Fällen so genannte Metadaten: Informationen darüber, was genau in einem Datensatz enthalten ist, wann er zuletzt aktualisiert wurde, wer dafür zuständig ist und unter welchen Bedingungen die Daten verwendet werden dürfen. In Deutschland hat sich als Standardmodell für Verwaltungs-Metadaten DCAT-AP etabliert. Durch Metadatenkataloge wie CKAN können auch größere Datenbestände übersichtlich durchsuchbar gemacht werden, was die Verwaltungsarbeit enorm erleichtern kann.
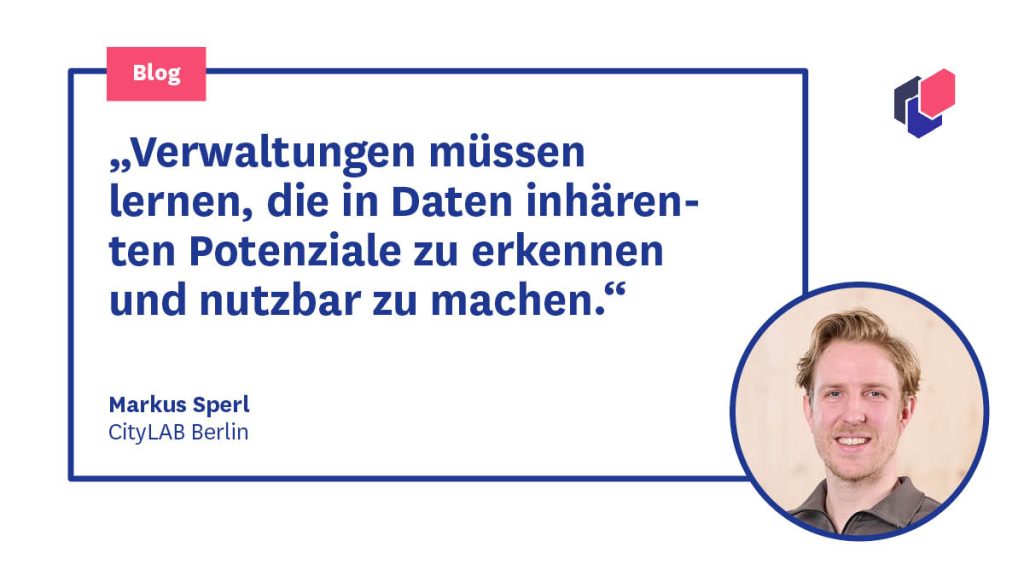
Fazit: Eierlegende Wollmilch-Datenplattformen?
Am Ende unserer Auseinandersetzung bleibt die Einsicht: Die eine „perfekte“ technische Lösung für verwaltungsübergreifendes Datenmanagement ist aktuell nicht in Sicht. Dafür ist das Problem auch schlicht zu facettenreich. Der vielversprechendste Ansatz liegt in einem gut orchestrierten Zusammenspiel verschiedener Komponenten. Für die wesentlichen Elemente, die zum Aufbau eines städtischen Datenmanagements benötigt werden, gibt es längst bewährte Lösungen. Die Herausforderung liegt darin, diese Bauteile zu einem funktionierenden System zu verknüpfen und parallel dazu die richtigen Strukturen, Prozesse und Kompetenzen in der Verwaltung zu entwickeln. Genau hier setzen wir an und freuen uns, den Prozess zur Erprobung und Etablierung einer urbanen Datenplattform zu begleiten.
Verwaltungen müssen lernen, die in Daten inhärenten Potenziale zu erkennen und nutzbar zu machen. Dies erfordert einerseits die Entwicklung maßgeblicher technischer Kompetenzen, andererseits aber auch den Aufbau von bislang bestenfalls rudimentär vorhandenden Governance-Modellen für städtische Daten. Es ist aus unserer Erfahrung sinnvoll, diese Schritte aus der Praxis heraus, also entlang realer Anwendungsfälle und Prototypen zu machen. Zugleich erfordern sie eine zentrale strategische Steuerung und den nachhaltigen Aufbau ressortübergreifender Prozesse und Strukturen.
[1] In Berlin existieren neben dem offiziellen Open Data-Portal des Landes noch eine Reihe weiterer öffentlich zugänglicher Datenportale, etwa das Geoportal, die Digitale Plattform Stadtverkehr, das Sozial-Informations-System, sowie die Seiten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg
